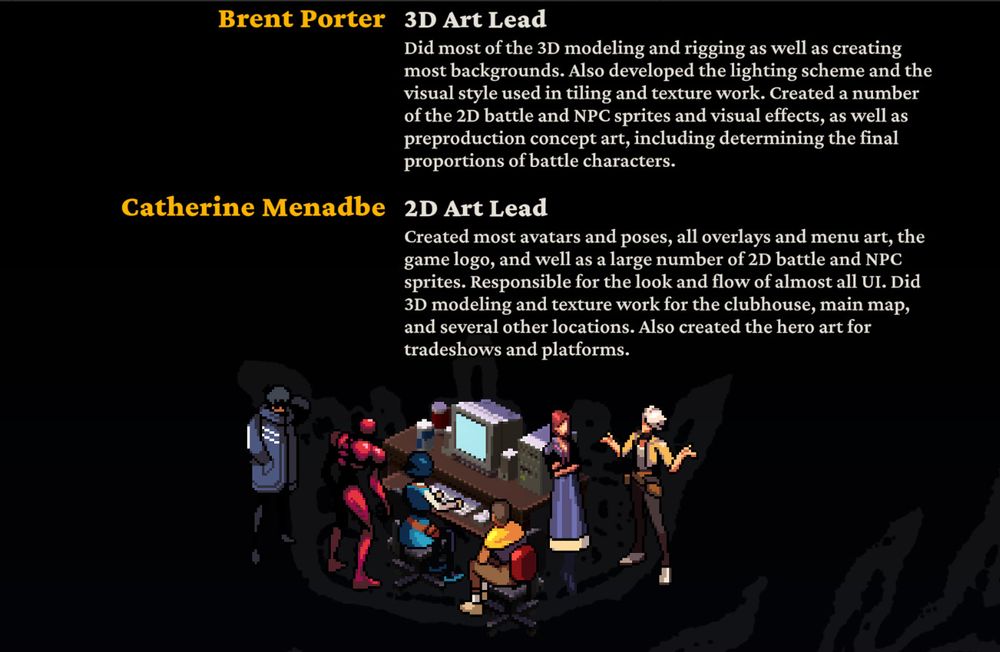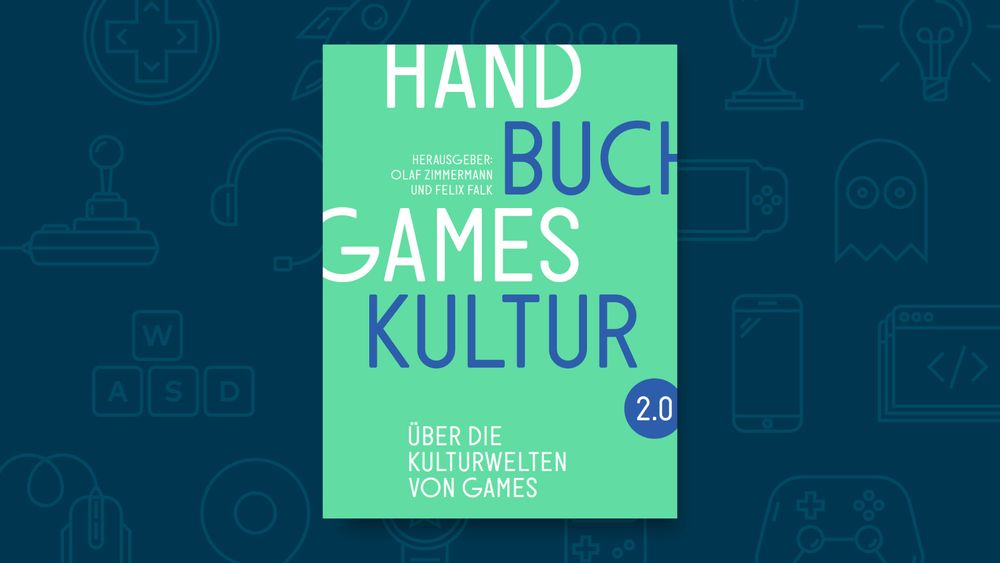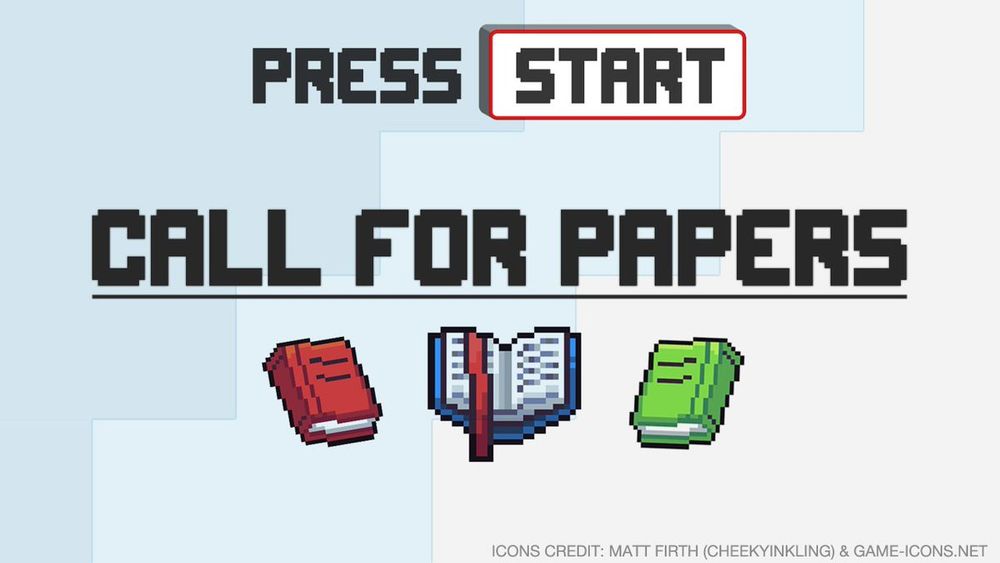Casual Politics. Politikwissenschaftliche Lesarten von Handyspielen (Casual Game Studies I)
## _von Arno Görgen_
_Handyspiele_. Jede*r kennt sie und fast alle unter uns haben schon mal welche gespielt. Sie sind in ihrem beiläufigen Gespieltwerden näher verwandt zu den frühen Computerspielen der Prä-3D-Ära der 1980er und 1990er Jahre als zu heutigen AAA-Titeln und sie gelten in gewisser Weise beinahe anrüchig als Junkfood der Spielebranche. Und wie die großen Schnellrestaurant-Ketten werfen sie die größten Gewinne der Spielindustrie ab.
> “Ein großer Teil des Umsatzes mit Games in Deutschland entfiel 2024 auf Spiele-Apps für Smartphone und Tablet. Dabei stieg der Umsatz mit Mobile Games hierzulande erstmals auf 3 Milliarden Euro. […] Mit Games für Spielekonsolen wurden rund 1,9 Milliarden Euro erzielt. Den drittgrößten Umsatz mit rund 1,5 Milliarden Euro erzielen Games für den PC.” (game 2025, 19)
Gleichzeitig sind sie aus medienkulturwissenschaftlicher, ideen- und medienhistorischer Sicht so gut wie unerforscht. Ihre politische, kulturelle und soziale Medienwirkung, überhaupt der ideologische Kosmos ihrer Inhalte und Spieldesigns ist akademisches Brachland. Im Folgenden möchte ich genau dazu eine Tür aufstoßen und zunächst einmal anhand der Begriffe “Mobile Games”, “Casual Games” und “Hyper Casual Games” definieren, was wir mit “Handygames”’” (die alle genannten Spieltypen inkludieren) meinen. In einem zweiten Schritt möchte ich skizzieren, inwiefern sich die Analyse von Handyspielen von der Analyse von Konsolen- oder PC-Spielen unterscheiden könnten.
## 1. **Differenzierung und Definition der Begriffe Mobile Game/Casual Game**
Mobile Games oder Handyspiele sind digitale Spiele, die in erster Linie für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets entwickelt oder an diese angepasst wurden. Aus medienanalytischer Sicht zeichnen sie sich durch drei wesentliche Momente aus:
1. _Technische und mediale Integration:_ Handyspiele sind an die technischen und infrastrukturellen Bedingungen mobiler Plattformen gebunden. Das bedeutet beispielsweise einerseits eine starke Anbindung an die jeweiligen App-Stores, aber auch technische Begrenzungen wie den Touchscreen als simultane Steuerungseinheit und als Bildschirm oder das Betriebssysteme. Dadurch entstehen neue Spielbarkeitsdispositive, die sich mitunter stark von Konsolen- und PC-Spielen unterscheiden. Zugleich ergeben sich auch aus der Mobilität neue Rahmenbedingungen, etwa durch die Möglichkeiten von Augmented Reality-Spielen oder standortgebundener Spiele, aber auch der grundsätzlichen Möglichkeit, asynchronen Spielens (im Sinne eines Spielens in kleinen Zeiteinheiten, s.u.).
2. _Wirtschaftliche und kulturelle Ubiquität:_ Fast jede*r Schweizer*in besitzt ein Smartphone. Dazu gehören auch Teenager*innen, von denen 98 % Mobiltelefone besitzen und intensiv nutzen (Külling-Knecht et al. 2024, 24–27). Im Durchschnitt spielen 56 % der Teenager*innen regelmäßig Handyspiele (ebd., 45) und 80 % der Teenager*innen spielen gelegentlich Spiele (ebd., 56). Die selbst eingeschätzte Spielzeit beträgt 1 Stunde 17 Minuten an Wochentagen und 2 Stunden 29 Minuten am Wochenende (ebd., 57). Eine Umfrage der Lobbyorganisation IGEM kommt zu dem Schluss, dass 40 % der Schweizer Bevölkerung (ab 15 Jahren) ihr Smartphone zum Spielen nutzen (IGEM 2024). Diese Allgegenwärtigkeit der Handyspiele, die zumindest in den Staaten Mitteleuropas in vergleichbarem Umfang gespielt werden, führt zu einem erheblichen Marktwert, und dazu, dass Handyspiele ein integraler Bestandteil der „App-Economy” sind. Sie zeichnen sich häufig durch Free-to-Play-Modelle, Mikrotransaktionen und Werbung aus. Gleichzeitig ist der Zugang zu den Spielen so niederschwellig, dass man im Vergleich zu den erheblich teureren Konsolenspielen von einer Demokratisierung des ökonomischen, räumlichen und praktischen Zugangs zu Spielen und einer Erweiterung der Zielgruppen sprechen kann.
3. _Soziokulturelle Praktiken_ : Mobile Spiele sind für situatives, ortsbezogenes und zeitlich fragmentiertes Spielen konzipiert (z. B. „Snack-Play” während Wartezeiten). Auf diese Weise verflechten sie den Alltag mit spielerischen Momenten und verwandeln Spielkulturen in allgegenwärtige, zwanglose Praktiken, führen aber zugleich auch zu einer situativen Abkapselung von der realen Umwelt. Die Spieler*innen versinken im Spiel, während gleichzeitig – oftmals bewusst – ein sozialer Austausch während des Spiels verunmöglicht wird. Zugleich finden sich in Spielen soziale Komponenten, die zugleich kompetitiv ausgerichtet sind, also Bestenlisten, Clanbildungen, zeitlich begrenzte Wettbewerbe, etc.
Während die Bezeichnung “Mobile Games” eher auf den Ort der Nutzung verweist (unterwegs, ortsunabhängig, auf mobilen Devices) wird mit dem verwandten Begriff “Casual Games” oder “Hyper Casual Games” (HCG) der Modus ihrer Nutzung und das damit verbundene Spieldesign verbunden.
Tatsächlich ist es nicht so einfach, HCGs von Casual Games zu unterscheiden. Folgt man der Beschreibung Nazife Ünals, liegt der Hauptunterschied darin, dass sich Casual Games eher durch In-App-Käufe finanzieren, während HCGs vor allem über Werbung finanziert werden. (Die Differenzierung dieser verschiedenen Typen von Mobile Games sollte für eine tiefere Analyse ein wichtiges Ziel zukünftiger Forschungsanstrengungen sein.) Folgende Ausführungen habe ich vor allem mit Bezug auf HCGs gemacht, sie gelten aber wie gesagt auch weitestgehend für Casual Games und, noch allgemeiner, Mobile Games.
HGCs sind ein Subgenre digitaler Spiele, das sich durch extreme Zugänglichkeit, minimale Spielmechanik, kurze Spielrunden und eine niedrige Einstiegsbarriere auszeichnet. Der Oberbegriff «Hyper-Casual Games» umfasst Spiele, die stark von Werbewirtschaft und Plattformlogik beeinflusst werden, die für kurze Aufmerksamkeitsspannen und hohe Reichweite konzipiert sind und oft datengesteuert entwickelt und vermarktet werden. Diese Art von Spielen ist in der Regel kostenlos und wird vor allem durch Werbung – manchmal auch durch In-App-Käufe (die Grenzen zum Casual Game sind hier fliessend) monetarisiert. Die Zielgruppe sind „Nicht-Gamer*innen” oder Gelegenheitsspieler*innen, die Spiele in kurzen, wiederholbaren Sitzungen spielen – zum Beispiel während Wartezeiten, auf dem Weg zur Arbeit oder in Pausen. (Juul 2010; Pizzo 2023, 1-3)
Es ist diese straff organisierte Struktur von HCGs und ihre extreme Fokussierung auf Einfachheit, attraktives Gameplay und wirtschaftliche Wertschöpfung, die sie von Natur aus politisch macht: Sie etablieren nicht nur Machtstrukturen zwischen Entwickler*innen/Publisher*innen und Spieler*innen, sondern auch zwischen Spieler*innen und Spielesoftware, in Multiplayer-Spielen zwischen Spieler*innen und Spieler*innen sowie zwischen Spieler*innen und Inhalten (und umgekehrt), wobei jede Seite in gewissem Maße von der anderen profitiert. Diese Machtverhältnisse enthalten immer einen politischen Impuls, da sie maßgeblich zur Schaffung des soziokulturellen Raums von Spiel/Spielerfahrung beitragen.
Gleichzeitig ist der Inhalt – darunter verstehen wir die Erzählung, die Ästhetik, das Gameplay, die Benutzeroberfläche und die oft allgegenwärtige Werbung – politisch, weil er den Zwecken dieser Beziehungen unterworfen ist. Es ist die Absicht der Entwickler*innen, eine Situation zu schaffen, in der die Spieler*innen das Spiel scheinbar mehr brauchenals umgekehrt. Das Hyper-Casual-Spiel „Tower Destiny Survival” (Playstrom2024) präsentiert beispielsweise ein Szenario, in dem die Spieler*innen nach und nach einen beweglichen Turm in verschiedenen zweidimensionalen Umgebungen bauen muss, der dann jedes Level durchlaufen muss, während er von Horden von Zombies angegriffen wird. Um erfolgreich zu sein, muss die*der Spieler*in den Turm aufrüsten, aber mit steigendem Schwierigkeitsgrad hängen diese Upgrades davon ab, dass die*der Spieler*in Boni „kauft”, indem sie*er Werbefilme ansieht. Gleichzeitig unterliegen viele dieser Werbespots selbst derselben kapitalistischen Logik des Fortschritts und perpetuieren diese Erzählung auch für das in der Werbung verlinkte Produkt. Das Zombie-Thema wiederum verweist auf antikapitalistische Erzählungen des Zombie-Genres, die sich seit den 1970er Jahren im Film etabliert haben (die hirnlosen, alles verschlingenden Untoten). Ohne einen weiteren narrativen Rahmen wird diese politische Darstellung jedoch gekapert und invertiert, da die*der Spieler*in nun exponentiell konsumieren muss, um in der unendlichen Levelgenerierung des Hyper-Casual-Spiels zu überleben. Aus den Interaktionen zwischen Spiel, Spieler*in und Produzent*innen entwickelt sich so eine Dreiecksstruktur, innerhalb der soziopolitische und wirtschaftliche Machtstrukturen vorbereitet und gefestigt werden.
Abb.: Tower Defense Survive mit In-App-Käufen und Werbung Abb.: Tower Defense Survive mit In-App-Käufen und Werbung Abb.: Tower Defense Survive mit In-App-Käufen und Werbung
Das Dreieck der gegenseitigen Wertschöpfung (_Spieler*innen_ wollen möglichst umfassende Unterhaltung aus dem _Spiel_ , die _Spielindustrie_ will möglichst nachhaltige monetäre Ausbeutung der _Spieler*innen_ über das _Spiel_) führt auf spielethischer Ebene zur Manipulation der Spieler*innen durch sogenannte Dark Patterns. Dark Patterns im Spieldesign sind bewusst eingesetzte Designstrategien, die Spieler*innen dazu verleiten sollen, Entscheidungen zu treffen, die nicht in ihrem besten Interesse liegen, sondern vielmehr den kommerziellen Zielen der Entwickler*innen dienen (z. B. längere Spielzeiten, höhere Ausgaben, größere Abhängigkeit). Diese Manipulationsmechanismen nutzen kognitive Verzerrungen, emotionale Auslöser oder mangelnde Transparenz, um das Verhalten gezielt zu beeinflussen. (King et al. 2019; Zagal et al. 2013)
## 2. **Problematisierung der Analyse**
Im Rahmen des SNF-Projektes _Horror – Game – Politics_ (HGP, 2018-2022) hatten Eugen Pfister und ich eine Methode der der Spielanalyse entwickelt, die die Ebenen der Produktion, des Inhaltes und der Rezeption digitaler Horrorspiele umfasst. Dieser methodische Zugang kann grundsätzlich auch auf Mobile- und Casual Games angewandt werden. Es sind jedoch – bisher vor allem anekdotisch – bedeutende Unterschiede festzuhalten, die ich im Folgenden skizzieren möchte:
1. Es ist anzunehmen, dass insbesondere die Produktionsebene noch unzugänglicher für eine Erforschung sein dürfte, als es bereits bei digitalen Horrorspielen (die klassisch für Konsole und PC entwickelt wurden) der Fall ist. Dies liegt insbesondere daran, dass sich die Branche dieser Spiele ihres Status als ludisches Junkfood bewusst ist und im Sinne sozialer Erwünschtheit lieber gar keine als schlechte Publicity durch offene und ehrliche Konversationen zulassen. Diese Beobachtung gilt dabei sowohl für direkte Experten*inneninterviews mit Vertretern aus der Branche, wie auch für im Internet zu findende mediale Zeugnisse von Interviews. Dies bedeutet auch, dass die Quellenlage in Form von Post Mortems und anderen Dokumenten eher dürftig sein dürfte. Für Hinweise, wie man hier die Schwelle für solche Gespräche senken kann, wäre ich äußerst dankbar.
2. Auch die Inhaltsanalyse fällt gegenüber den Konsolen- und PC-Titeln, die wir bei HGP analysiert haben, etwas anders aus. Zu beachten ist, dass bei Casual Games die narrative Ebene – sofern es sie überhaupt gibt – deutlich abstrakter ausfällt. Das heißt, es gibt oftmals ästhetische, an ein bestimmtes Setting anschließende Stile, die dann mehr oder weniger kohärent das jeweilige Leveldesign ästhetisch organisieren, zugleich aber bei gleichbeibenden Spielmechaniken austauschbar sind (sh. _Angry Birds_ , _Angry Birds Star Wars_). Komplexe Narrative finden sich eher selten, dies oft eher bei Portierungen von PC- und Konsolentiteln auf das Handy. Zugleich ist man bei den Casual Games damit deutlich näher an den frühen digitalen Spielen bis Anfang der 1990er als es die AAA-Titel heutzutage sind. (auch diese Parallelen und Unterschiede wären durchaus einen analytischen Blick wert).
_Angry Birds: Star Wars_ und _Angry Birds 2_ im Vergleich: Anderes Setting, (überwiegend) gleiche Mechanik _Angry Birds: Star Wars_ und _Angry Birds 2_ im Vergleich: Anderes Setting, (überwiegend) gleiche Mechanik
3. Während also die Analyse von Narrativen und World Building-Elementen reduzierter ausfallen könnte, müssten andere Bereiche stärker gewichtet werden. Das Gameplay ist beispielsweise auf Einfachheit und schnelle Konsumierbarkeit ausgerichtet, verfolgt aber zugleich das Ziel der Spielwiederholung und -fortsetzung. Solche darin implizierten Autonomiegefälle von Spiel zu Spieler*in zu identifizieren, diese sowohl an den rudimentären Überbau des Spiels, aber auch an die Wertschöpfungsmechanismen des Spieles und damit an die Machtpraktiken der Entwickler*innen zu koppeln, sollte ein vorrangiges Ziel sein.
4. Gleichzeitig ist zu beachten, dass sich auch die Spiele im Ganzen im Vergleich zu klassischen Konsolentiteln im historischen Verlauf erheblich mehr verändern, da es hier stetige Updates geben kann, die Gameplay, Ästhetik und sogar die Story verändern können. So gibt es hier saisonbedingte Events wie zum Beispiel zu Feiertagen oder JAhreszeiten, oder wie ich im Falle des bereits genannten _Tower Defense Survive_ feststellen konnte, kann das Gameplay im Balancing erheblich umgestellt werden und leichter oder schwerer werden, indem in den Spielrunden bspw. mehr oder weniger Währung verdient werden kann. Eine genaue Dokumentation der gespielten Version ist also notwendig und ein Vergleich von Versionen wäre zumindest wünschenswert. Diese Dokumentation sollte nach Möglichkeit Videos einschliessen, die die Veränderungen festhält.
5. In einem ähnlichen Kontext bewegt sich auch die Analyse von Monetarisierungselementen: wie sind diese integriert, wie aggressiv sind sie und inwiefern greifen sie in die Spielmechaniken und die Spielfortschritte ein? Ist also ein sinnvolles Spielen ohne die Investition in In-App-Käufe möglich? Wie sind diese Elemente designt und wie nachhaltig sind solche Käufe für das folgend ‘aufgepowerte’ Spiel?
6. Schließlich stellt ein weiteres Element einen deutlichen Unterschied zu klassischen Spielen dar. Werbeunterbrechungen und Werbung als Währung für Power-Ups und andere spielmechanische Hilfestellungen nehmen massiv Einfluss auf das Gameplay, stehen aber eigenwillig auch außerhalb des Spiels. Diese müssen also einerseits als eigene ästhetische Kategorie begriffen werden, aber auch als spielmechanisches Element im Rahmen des jeweiligen Casual Games verstanden werden. Hier die richtigen Analysekategorien zu finden, steht noch aus. Insbesondere die Genderperspektive würde sich hier lohnen, reproduzieren doch viele dieser Werbeeinschübe oft auf krude Art unreflektiert Gender-Stereotype, die sich durch Sexualisierung, Othering und andere Prozesse auszeichnen. Weitere Fragen, die sich hier stellen, sind, wie Grundsätzlich die Infrastruktur hinter den Werbeschaltungen auf Produktions- und technischer Ebene aussehen, und wie man solche Werbeschaltungen am besten methodisch erforscht, wie man sie konserviert, etc.
Abb.: Filmwerbung, spielbare Werbung und und Werbung als Spielerklärpräsentation Abb.: Filmwerbung, spielbare Werbung und und Werbung als Spielerklärpräsentation Abb.: Filmwerbung, spielbare Werbung und und Werbung als Spielerklärpräsentation
7. Schließlich bleibt noch die Frage der Rezeptionsanalyse. Bereits bei HGP war diese die unzugänglichste Ebene, und auch bei Handyspielen stellt sich die Frage, welche Rezensionsplattformen hier die gängigsten sind, welche sich am ehesten für eine Textanalyse eignen. Problematisch kommt hier hinzu, dass viele Spiele spielmechanisch dazu anreizen, dass man sie positiv bewertet und dafür Power-Ups und ähnliches erhält. Es stellt sich folglich die Frage nach der Wertigkeit getaner Aussagen.
## **Schluss**
Während also Handyspiele allein schon aufgrund ihrer Allgegenwart in einer durchmobilisierten und durchdigitalisierten Umwelt zwingend eines kritisch-analytischen Blicks bedürfen, ist die Frage nach der methodischen Umsetzung einer solchen Forschung von relativ vielen Fragezeichen begleitet. Das Ziel hierfür muss ganz im Sinne der Grounded Theory eine Forschungsstruktur sein, die Puffer lässt für Anpassungen, zugleich aber die Forschungsfragen nicht aus den Augen lässt.
* * *
## **Literatur**
* game – Verband der deutschen Games-Branche (2025): _Jahresreport der deutschen Games-Branche 2025_. Berlin. https://www.game.de/jahresreport-der-deutschen-games-branche-2025-veroeffentlicht/.
* IGEM. (n.d.). _Digimonitor Studie Mediennutzung Schweiz_. IGEM – Interessengemeinschaft Elektronische Medien Schweiz. https://www.igem.ch/digimonitor-studie-mediennutzung/
* Juul, J. (2010). _A casual revolution: Reinventing video games and their players_. MIT Press.
* King, D. L., Delfabbro, P. H., Gainsbury, S. M., Dreier, M., Greer, N., & Billieux, J. (2019). Unfair play? Video games as exploitative monetized services: An examination of game patents from a consumer protection perspective. _Computers in Human Behavior, 101_ , 131–143. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.07.017
* Külling-Knecht, Céline; Waller, Gregor; Willemse, Isabel; Deda-Bröchin, Svenja; Suter, Lilian; Streule, Pascal; Settegrana, Nicolò; Jochim, Mirjam; Bernath, Jael; Süss, Daniel (2024): JAMES – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
* Pizzo, A. D. (2023). Hypercasual and hybrid-casual video gaming: A digital leisure perspective. _Leisure Sciences_ , 1–20. https://doi.org/10.1080/01490400.2023.2211056
* Playstrom (2024):Tower Destiny Survive. Say Games Ltd.
* Zagal, J. P., Björk, S., & Lewis, C. (2013, May 16). Dark patterns in the design of games. http://www.fdg2013.org/program/papers/paper06_zagal_etal.pdf
* * *
_Bild: Artwork des Entwicklers zum Spiel Singularity_
_Empfohlene Zitierweise :
_ Arno Görgen, “Casual Politics. Politikwissenschaftliche Lesarten von Handyspielen (Casual Game Studies I)” in: Spiel-Kultur-Wissenschaften, <http://spielkult.hypotheses.org/8372> 15.10.2025.
* * *
OpenEdition schlägt Ihnen vor, diesen Beitrag wie folgt zu zitieren:
Arno Görgen (15. Oktober 2025). Casual Politics. Politikwissenschaftliche Lesarten von Handyspielen (Casual Game Studies I). _Spiel-Kultur-Wissenschaft_. Abgerufen am 15. Oktober 2025 von https://spielkult.hypotheses.org/8372
* * *
* * * * *